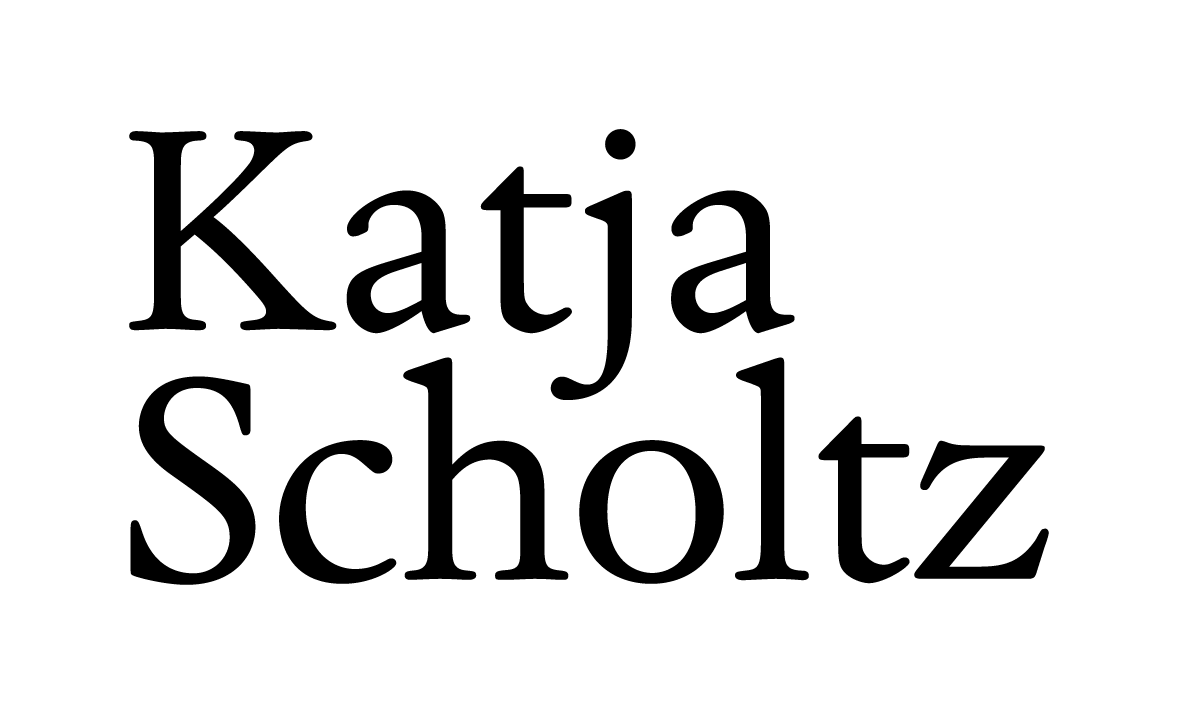„Von unbändiger literarischer Kraft und erschütternder Schönheit“
Klappen- und Vorschautexte: ein Serviceangebot Adjektive einzigartig, leidenschaftlich, atemberaubend, bahnbrechend, spitzfindig, zeitlos, tiefgründig, kongenial, identifikatorisch, pointiert, sprachgewaltig, wortgewaltig, mitreißend, packend, fesselnd, inspirierend, vielschichtig, feinsinnig, überwältigend, brillant, magisch, lebendig, unwiderstehlich, mitfühlend, kraftvoll, visionär, verfremdend, schockierend, einfallsreich, schillernd, raffiniert, herrlich, humorvoll, bissig, skurril, unerschrocken, wahrhaftig, klug, lehrreich, sensibel, literarisch, schonungslos, suggestiv, ...
> Weiterlesen