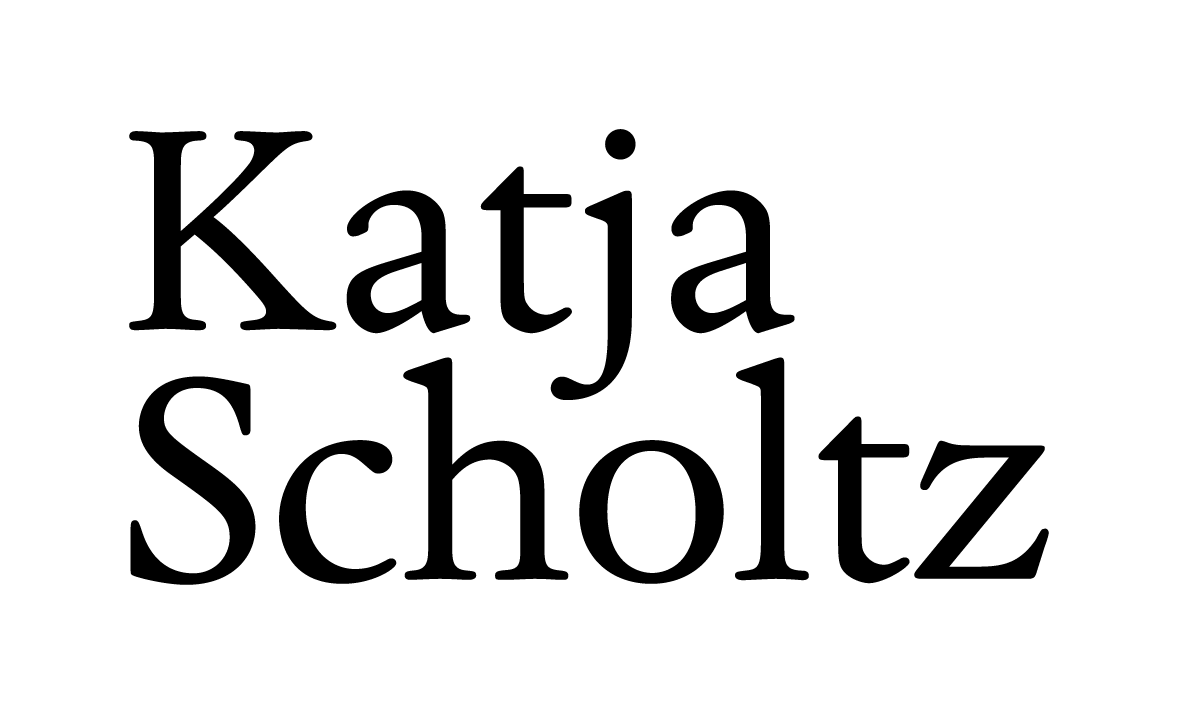Die Flaute
Unlängst hatte ich Gelegenheit, eine alte Gewissheit zu erneuern: Ich bin kein Typ fürs Segeln. Natürlich verstehe ich den Reiz dieser Technik – sich vorwärtszubewegen allein mit der Kraft des Windes – ebenso wie ihre einstige Notwendigkeit. Gewürze transportieren, Amerika entdecken, auswandern, wie hätte es anders gehen sollen als mit dem Schiff? Vor allem verstehe ich die romantische Idee von der Freiheit auf See und bin für die Ästhetik des Ganzen mehr als empfänglich. Unter einem geblähten weißen Segel sanft durch die südschwedische Schärenlandschaft zu gleiten, in der zwischen Kiefern, Birken und Espen immer wieder kleine rote Häuser aufleuchten, ist, ich kann es nicht anders sagen, wunderschön. Ein Traum eigentlich. Für zwei Stunden ungefähr. Nach zwei Stunden aber würde ich dann gern ein bisschen spazieren gehen. Oder lesen. Oder eine Tür zumachen und für mich sein. Was bedeutet eigentlich „Freiheit auf See“, wenn man nirgends hinkann?
Auch die Segler wissen oft nicht, wohin. Denn plötzlich flaut der Wind ab. Und jetzt? Zurück in den Hafen oder lieber in eine kleine Bucht vor Anker? Nachts soll der Wind wieder zunehmen. Liegt man in der Bucht geschützt genug, wenn der Wind genau zur Öffnung reinpfeift? Schwer zu sagen. Überhaupt ist alles schwer zu sagen. Die Crew diskutiert, betrachtet Karten und Plotter, rechnet, kurbelt Winschen, zieht an Leinen, will reffen, dann doch lieber nicht reffen, macht Knoten, löst die Knoten wieder, ruft sich unverständliche Dinge zu, entscheidet sich dann für die Bucht, schmeißt irgendwann den Anker, überlegt, ob das Schiff schwojet und wenn ja, wohin, und in diesen Momenten, in denen ich weniger verstehe als auf Schwedens Schildern („Västervik: Ostkustens pärla“ – ist doch klar?), fällt mir jedes Mal Jack Londons „Die Reise mit der Snark“ ein. Vermutlich genau deshalb eines meiner Lieblingsbücher im mare-Programm: Obwohl sich der Autor, anders als ich, für das Segeln und die Freiheit auf See begeistern konnte, hat er auch nix kapiert. Vor allem nicht, wenn es um Navigation ging: „So huldigte er [Roscoe, der Hilfsnavigator] mit dem Sextanten dem Sonnengott, er konsultierte uralte Folianten mit magischen Zeichen, murmelte Gebete in einer fremden Sprache, die sich anhörten wie Indexfehlerparallaxenrefraktion, und dann legte er seinen Finger auf einen auffallend leeren Punkt auf einem Blatt der Heiligen Schrift, die man den Gral, ich meine, die Seekarte nannte, und sprach: ‚Wir sind hier.‘ Als wir die leere Stelle betrachteten und fragten, ‚Wo ist das?‘, antwortete er im Zifferncode der höheren Priesterkaste, ‘31 – 14 – 47 Nord, 133 – 5 – 30 West‘. Und wir sagten ‚Oh‘ und fühlten uns schrecklich klein.“
Dass diese Reise (bei der die Navigation längst nicht das größte Problem war, denn der Schiffskoch konnte nicht kochen, die Crew war dauernd seekrank, die Sicherheitsschotten undicht) als vermutlich glücklichste Zeit in Jack Londons kurzem Leben gilt, ist nur erklärbar durch Leidenschaft. Durch diese verrückte, sinnlose Liebe, die es braucht, um das Rechnen, Schwojen, Reffen, Winschen, überhaupt dieses ganze Geacker an Bord, die blauen Flecken, Flauten, Ungewissheiten und den Camping-Komfort freiwillig auf sich zu nehmen. Man muss es einfach lieben, um des Segelns willen zu segeln. Jack hatte diese Liebe. Ich nicht. Meine Liebe steuert das Boot, und als ich nach fünf Nächten von Bord gehe, bin ich froh, dass sie ab jetzt gen Süden segelt und in etwa einer Woche im Heimathafen festmachen wird. Bis dahin lese ich noch ein bisschen.