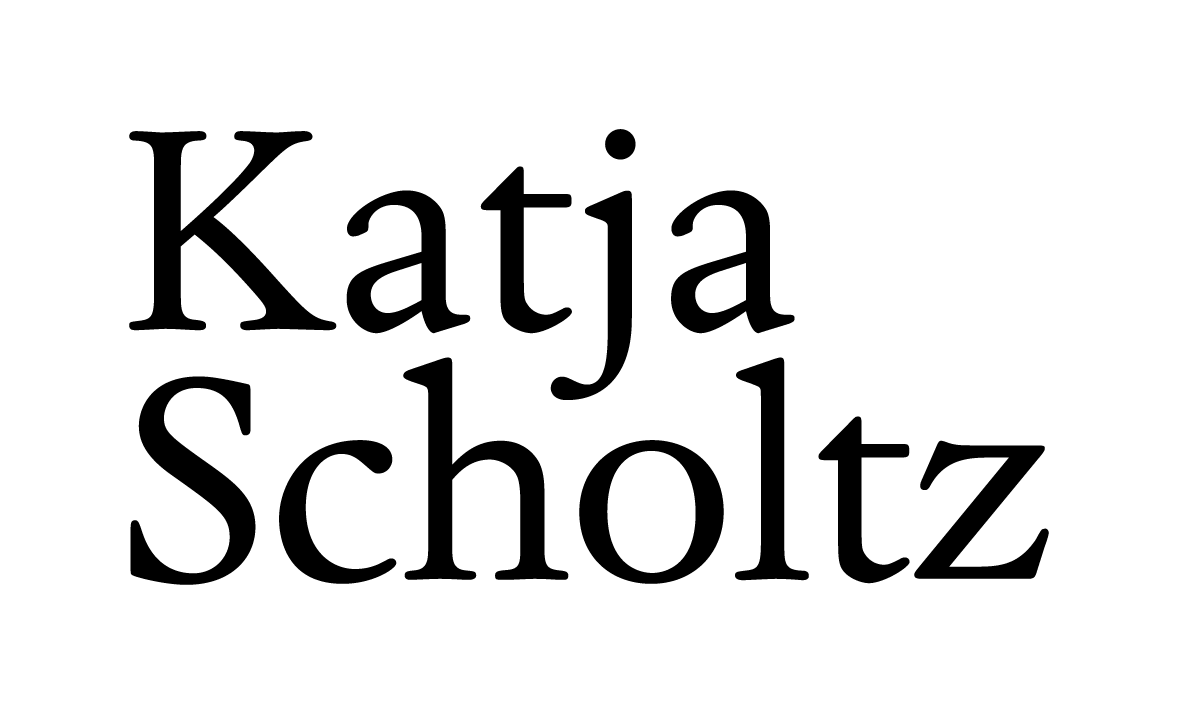Mein ganz privates Sudoku
Zu den Merkwürdigkeiten des Älterwerdens gehört es, zunehmend Ähnlichkeiten mit den eigenen Eltern festzustellen. Während ich früher Augenfarbe und Form der Fingernägel für die einzigen Anzeichen verwandtschaftlicher Zugehörigkeit hielt, weiß ich heute, dass die Parallelen zu meiner Mutter weit umfänglicher sind. Fenster aufreißen, sobald irgendwo Glocken zu hören sind, keine Krümel auf Arbeitsflächen tolerieren, jedes Tier anfassen wollen, es kommt mir alles ziemlich bekannt vor.
Und während es mir früher absolut rätselhaft war, warum meine Mutter Woche um Woche mit großer Konzentration die Todesanzeigen der WAZ las, so mache ich es heute genauso, außer dass die Zeitung eine andere ist und meine Konzentration eventuell noch höher als ihre. Möglich, dass es mit dem Alter zu tun hat und mit der von der bloßen Vermutung zu gesichertem Wissen ausgereiften Erkenntnis, dass es nicht nur die anderen sind, die sterben. Und dass es von daher nicht schaden kann, sich mit dem Gedanken beizeiten vertraut zu machen. Dazu passt, dass ich in allen Anzeigen sorgfältig die Jahrgänge der Verstorbenen untersuche: 1971 ist ganz schlecht. Alles darüber sowieso (völlig unerträglich). Alles darunter aber auch. Bis vor etwa fünfzehn Jahren konnte ich maximal die Geburtsjahrgänge meiner Großeltern akzeptieren, aber da diese Generation inzwischen ausgestorben ist, müsste ich eine neue Grenze gelten lassen, doch da weigere ich mich.
Allerdings rätsle ich nicht nur über ein akzeptables Alter zum Sterben. Ich rätsle genauso über Todesursachen (Aneurysma, Unfall, Krebs, Suizid?), über Vor- und Nachnamen (69 geboren, und sie hieß Bärbel?), über Adelsgeschlechter, akademische Titel oder familiäre Beziehungen, wobei ich an Patchwork-Konstellationen, die natürlich am spannendsten sind, regelrecht verzweifeln kann. Zuweilen habe ich bei dem (meist vergeblichen) Versuch, die genauen verwandtschaftlichen Verhältnisse aufzudröseln, länger über einer einzigen Anzeige gebrütet als über dem gesamten Rest der Zeitung. Ich glaube, das Studium von Todesanzeigen ist mein ganz privates Sudoku.
Wenn es wenigstens nur das wäre: bisschen rechnen, rätseln und über den Tod sinnieren. Aber leider kommt auch mein leidiger Korrekturzwang mit ins Spiel, der seltsam entkoppelt scheint von jener Abteilung im Innern, die für Moral und Pietät zuständig ist, und vor keiner Textgattung haltmacht, egal ob Buch, Betriebsanleitung oder Beipackzettel. Oder eben Todesanzeige. Fast gierig spießt mein Auge sämtliche Fehler auf und markiert heimlich vernachlässigte Genitive (Wir gedenken dem Verstorbenen), fragwürdige Anführungszeichen („sanft“ entschlafen), eigenwillige Apostrophe (Emil’s letzte Reise) oder, jedenfalls während der traurigen Jahre der Pandemie, die zahlreichen kreativen Schreibweisen des Wortes „coronabedingt“. Vom ungewollt Komischen ganz zu schweigen. Formulierungen wie „Er hat den langen Kampf gegen die Gesundheit verloren“ oder „Nach schwerer Krankheit geben wir traurig bekannt“ können meine Gefühle in ähnlichen Widerstreit bringen wie „Wir schätzten ihn als Meister im Minigolfspiel“ – oder auch: „Sie hatte noch so viel vor“ (Jahrgang 1927). Denn darf man mitten im Mitgefühl überhaupt etwas komisch finden? Über Formulierungen lachen, die Menschen finden mussten unter den allerschmerzlichsten Bedingungen? Oder kann genau darin sogar Trost liegen? Der Shakespeare’sche Clown (der „fool“ oder „jester“) hatte schließlich auch seine Funktion, und zwar gerade in den großen Dramen. Dennoch sagt eine bestimmte Stimme in mir hörbar Nein (liebe Grüße, Pastor Blau!). Während eine andere, weniger strenge Stimme mich an die Todesanzeigensammlung des Börsenverein-Justiziars Christian Sprang erinnert, die er 2003 im Netz begann und so erfolgreich wurde, dass vier noch erfolgreichere Bücher aus ihr hervorgehen sollten – angefangen bei „Aus die Maus“ mit über 200 000 verkauften Exemplaren bis hin zu „Eine tapfere Leber hat aufgehört zu arbeiten“. Wie immer scheint im Leben viel vermeintlich Unvereinbares nah beieinander zu liegen oder sogar direkt miteinander verwandt zu sein. Der Flop und der Bestseller, der Dativ und der Genitiv, das Tragische und das Komische.
Fest steht außerdem, dass die Todesnachrichten viel verraten über uns Lebende. Nicht nur über diejenigen von uns, die gezwungen sind, sie zu schreiben. Sondern auch über die, die sie lesen. Ich, so viel wird mir klar, zeige eine Menge von dem, was ich bin: die ewige Korrekturleserin (die obendrein selbst oft genug ins Straucheln kommt), die gut trainierte Protestantin, die Tochter meiner Mutter, die Rühr- und Amüsierbare, die David-Sedaris-Leserin und Spelling-Bee-Süchtige, die Neugierige und sich für alles Menschliche übermäßig Interessierende. Und die mit der Angst vor dem Tod.