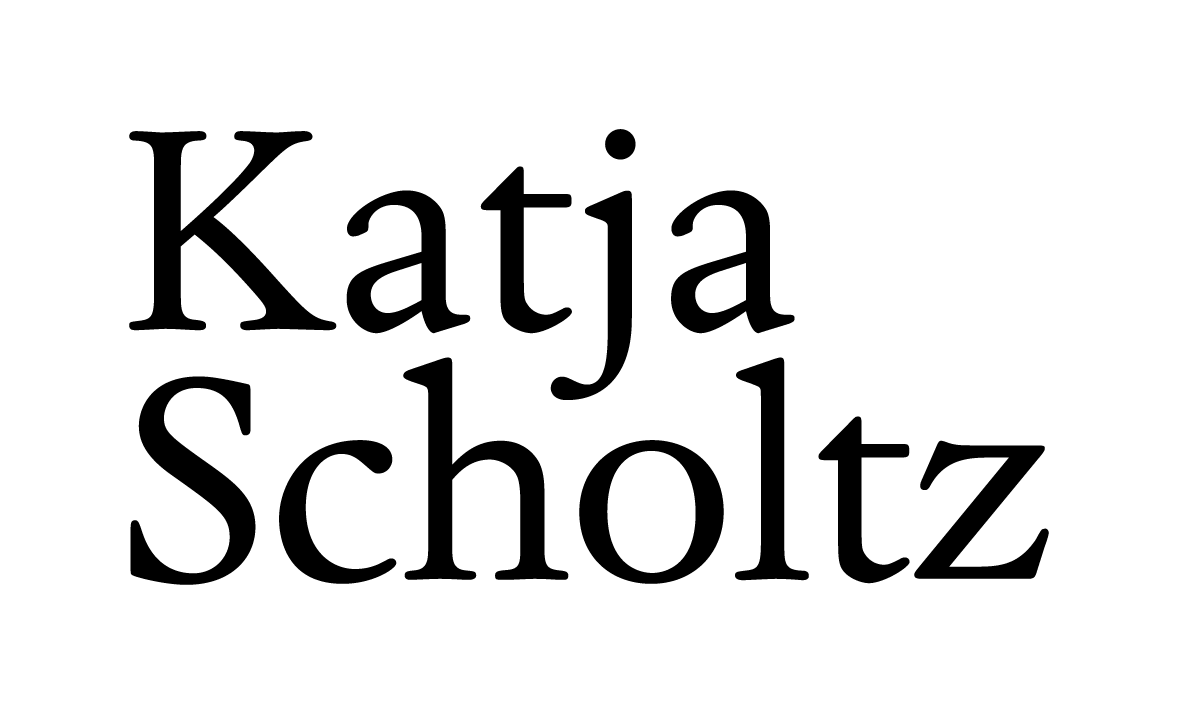„Beim Klavierspiel komme ich ganz zu mir selbst, als Autor bin ich eine vielgestaltige Person – mal verunsichert, mal zuversichtlich, mal zweifelnd, mal selbstsicher, mal ganz nackt.“
Jens Rosteck, Jens Rosteck Schriftsteller, Musikwissenschaftler, Pianist
Wie sieht ein normaler oder idealer Arbeitstag für dich aus, was für einen Rhythmus hast du? Hast du feste Arbeitszeiten oder sehr unterschiedliche?
Wenn keine Konzerte zu absolvieren sind oder ich mich nicht auf Lesereise befinde, sitze ich, von kurzen Pausen für Mahlzeiten abgesehen, praktisch ununterbrochen am Schreibtisch, von acht bis zwanzig Uhr. Morgens begleitet mich dabei eine Kanne grüner Tee, nachmittags hilft mir (wahrscheinlich viel zu viel) Kaffee auf die Sprünge. Reine Schreibzeit davon sind um die fünf bis sechs Stunden. Mit der Niederschrift komme ich rasch vorwärts, wenn ich mich erst einmal auf einen bestimmten Gedankengang eingelassen habe und mich in die Lage versetze, ihn auch konsequent weiterzuverfolgen. Das muss sich einpendeln, gelingt nicht auf Knopfdruck; gelegentlich zwingt man sich mit einer Portion Selbstüberredungskunst, eine Haltung einzunehmen, mit der sich das tägliche Pensum bewältigen lässt.
Rhythmisiert wird mein Arbeitstag durch ausgiebiges Klavierspiel am Flügel – mehrfach pro Tag, eine Etage tiefer bei uns zu Hause. Manchmal nur für zehn Minuten. Das kann aber auch eine ganze Stunde oder mehr in Anspruch nehmen; ich folge meinen Launen, plane meine Zeit an den Tasten nicht – im Gegensatz zu meiner Zeit an der Tastatur! Richtig proben oder üben muss ich dabei, als Pianist, eigentlich nicht mehr, jahrzehntelange Routine spielt mir gewissermaßen in die Hände. Ich feile an einzelnen Stücken/Kompositionen oder poliere sie auf, improvisiere, lasse mich treiben oder sinne beim Spielen über literarische Gebilde, d.h. über Sätze, Formulierungen und Ideen nach, die dann in meinem „mind“ Gestalt annehmen. Und die ich im Anschluss „oben“, also im Arbeitszimmer, unbedingt verwenden möchte. Kaum abwarten kann ich es in einem solchen Augenblick, wieder an den Rechner zurückzukehren und reiße mich dann von der Klavierbank förmlich los. Daher empfinde ich es als Chance oder Bereicherung und keinesfalls als Belastung, dass ich als Kreativer ständig zwischen Musizieren und Textproduktion hin- und herspringen oder -switchen kann. Momente der Kontemplation und Inspiration lösen einander ab, das wirkt beflügelnd und befriedigend. Beim Musizieren kann ich loslassen, beim Schreiben beiße ich mich gerne fest. Beim Klavierspiel komme ich ganz zu mir selbst, als Autor bin ich eine vielgestaltige Person – mal verunsichert, mal zuversichtlich, mal zweifelnd, mal selbstsicher, mal ganz nackt, mal im vollen Bewusstsein, wirklich Experte für eine der von mir porträtierten Figuren oder Protagonisten zu sein. Widersprüche zwischen diesen beiden Persönlichkeitshälften gibt es aber keine: Sie ergänzen sich vielmehr.
Unterscheiden muss man jedoch zwischen Vorbereitungs-, Recherche-, Sortier-Tagen, an denen Vorarbeiten stattfinden, nachgeschlagen und auch sehr viel nachgedacht, geprüft, selbstkritisch geplant werden muss, und „reinen“ Schreibtagen, wo ich mich in einen veritablen Rausch begebe und das Buch bzw. das jeweilige Kapitel so schnell und flüssig wie möglich zu Papier bringen möchte. Einfach erst mal weiterschreiben, versuchen, alles Nebensächliche auszublenden, vorwärtskommen, lautet hierbei die Devise. Ich bin niemand, der zu Beginn eines Abschnitts um jeden Satz ringt, sondern arbeite viel besser verschwenderisch, mit anschließender strenger Reduzierung. Zuerst wird also viel Farbe, viel „Information“ auf die Textleinwand aufgetragen, nur um das Meiste davon später wieder zu eliminieren, ja wegzuwischen. Vom Üppigen weg zum tatsächlich Aussagekräftigen.
Kannst du sagen, wie viele Stunden pro Tag du im Durchschnitt netto arbeitest (schreibst, malst, übst)? Wie viel kommt im besten Fall dabei heraus (zwei Seiten, eine Skizze, zwanzig Takte)?
An einem „guten“ Tag bleiben abends ungefähr fünf bis sechs brauchbare Norm-Seiten stehen, was den schon erwähnten, konzentrierten fünf bis sechs „Netto“-Stunden entspricht. Am nächsten Morgen unterziehe ich sie allerdings einer äußerst kritischen Prüfung, streiche und verwerfe, modifiziere, radiere und kürze, stelle um oder verändere die Ausrichtung; mindestens ein Drittel davon fällt dann unter den Tisch. Damit beginne ich stets und finde bei diesem Auslöschungsprozess auch genau wieder jenen im Idealfall authentischen Ton(fall) oder jenen möglichst plausiblen Duktus, an den ich anknüpfen will und mit dessen Nutzung ich weiterzuschreiben vermag. Oftmals, in der Endphase eines Manuskriptes, wenn ich mich der Fertigstellung nähere und auch gern zügig zum Finale vordringen möchte, setze ich mich noch einmal abends spät hin, etwa gegen 23 Uhr und zuweilen bis 1 Uhr morgens. Bei diesen Nachtsitzungen sammle ich eher Ideen für den Folgetag, formuliere selten etwas aus. Eine solche Ergänzungs-Session hilft mir indessen, über Nacht nicht den Faden zu verlieren. Einzelne Begriffe, stilistische Wendungen, prägnante Sätze oder originelle Überlegungen spuken dann während der Schlafstunden im Kopf herum und liegen am nächsten Morgen sozusagen parat. Ich muss sie dann nur noch abrufen. Bisweilen verflüchtigen sie sich im Traum, bisweilen vergesse ich sie auch wieder. Doch die „Richtung“ und auch der Impuls stimmen jedes Mal.
Bevor ich ein neues Buchprojekt angehe, entwerfe ich einen präzisen, verbindlichen Zeitplan und eine vorläufige Gliederung. Im Laufe der Wochen und Monate verändert sich selbstverständlich in Bezug auf Inhalt und Ausrichtung vieles, wenn nicht alles daran. Selten nur hinke ich aber meiner Zeiteinteilung und Seitenplanung hinterher. Wenn ich zu lange prokrastiniere, fühle ich mich nämlich zutiefst unwohl. Lieber bin ich etwas zu früh mit allem fertig und nutze die freigewordene Zeit zu noch mehr Korrekturen, Umformulierungen und Streichungen. Und irgendwann kommt, gottlob, der Punkt, wo man selbst den Schlussstrich setzen und sich ein „Basta!“ zurufen muss; jegliche weitere Bastelei am abgeschlossenen Text ist dann eher schädlich oder kontraproduktiv. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich dem Urteil Dritter stellen sollte, sich für seine Verteidigung wappnen und das Resultat kompetenten Menschen vorlegen muss.
Wie viele Stunden kommen durchschnittlich hinzu für „Hintergrundarbeiten“ und alles andere (Recherchen, Bürokram, Akquise, Website, Social Media)? Wie findest du die Balance zwischen all den Aufgaben, die du als freischaffende:r Künstler:in im Blick behalten musst?
Grundsätzlich geht das alles ineinander über, fällt demnach in die „anderen“ sechs täglichen Stunden am Schreibtisch. Bevor ich einen Buchtext (oder auch einen Essay) in Angriff nehme, liegt die Recherche meist bereits hinter mir. Die Erledigung lästiger, jedoch notwendiger Pflichten wie Bürokram und Pflege der Website fällt im Grunde täglich an, ebenso das Schreiben langer, briefartiger E-Mails, das Führen von Verhandlungen über bevorstehende Lesungen, die Archivierung von Bildmaterial (für Bücher oder von Auftritten). Hinzu kommt, dass ich mich in den letzten drei, vier Jahren nolens volens um recht komplizierte Erbschaftsverhältnisse kümmern muss(te) – meine Eltern sind während der Pandemie-Jahre verstorben. Das ist mit ungeheuer viel Bürokratie verbunden, da kommt immer mal wieder etwas Unvorhersehbares hinzu, was sofort erledigt werden muss und keinen Aufschub duldet.
Social Media: Das ist ein heikler, um nicht zu sagen wunder Punkt. Da ein Großteil meiner Freunde und Kolleginnen in Frankreich und Spanien, in den USA oder in Großbritannien oder weit von mir entfernt in deutschen Großstädten lebt, investiere ich dafür recht viel Zeit. Das Aufrechterhalten und Mit-Leben-Erfüllen dieser Kontakte ist mir hingegen auch sehr, sehr wichtig. Auf Facebook und dergleichen bin ich auch schon deswegen angewiesen, weil ich über diese Kanäle – wie auch über die fast tägliche Aktualisierung meiner Homepage – auf meine Veranstaltungen und Veröffentlichungen hinweisen und dafür werben kann. Im Nachgang publiziere ich dort auch immer eine Nach-Lese, indem ich Kritiken und Bilder von diesen für mich bedeutsamen Events ins Netz stelle. Ob ich die richtige Balance zwischen den diversen Aufgaben finde, können wahrscheinlich Mitmenschen und Beobachter meines Tuns besser beurteilen als ich selbst. Nicht selten fühlt es sich an wie eine permanente logistische oder kommunikative Überforderung. Doch bin ich, was meine Persönlichkeitsstruktur angeht, eben auch kein Mensch, der nur im stillen Kämmerlein agieren könnte. Ganz ohne Außenwelt mag ich nicht existieren oder kreativ sein.
Gibt es Wochenenden für dich? Was bedeutet Freizeit?
Wochenenden – unbedingt. Mit meinem (französischen) Mann finde ich Entspannung und Abwechslung bei Wander- und Radtouren, beim Schwimmen, beim Besuch von Ausstellungen, bei den Begegnungen mit Freunden. Obwohl auch an Sams- und Sonntagen natürlich immer ein paar Stunden fürs Schreiben, Mailen und Musikmachen „draufgehen“. Hundertprozentig abschalten kann und möchte ich auch gar nicht von den jeweils in Arbeit befindlichen Vorhaben. Freizeit und Arbeitszeit bilden bei mir, wie sicherlich bei vielen Freiberuflern, eine Einheit, das eine gleitet in das andere. Es gibt keinen Feierabend, keine festen Zäsuren für Mahlzeiten, keine einzuhaltende Wochenstundenarbeitszeit für mich. Um ein Diktum von Marguerite Duras zu paraphrasieren: Wenn man als Künstler schreibt (oder musiziert), schreibt man immer. Auch wenn man gerade nicht „aktiv“ schreibt, sondern lebt, atmet, läuft, schwimmt, liest, liebt – also auch wenn man ausnahmsweise „nichts“ tut. Nichtstun: sowieso ein Ding der Unmöglichkeit.
Was ist die größte Gefahr für dein künstlerisches Schaffen, wovon lässt du dich ablenken?
Von neuer Musik, die ich einstudieren möchte. Von den Veröffentlichungen anderer, die mich interessieren, anregen und anspornen. Ich schaue gern viel, womöglich zu viel, über den eigenen Tellerrand. Dabei fühle ich mich aber weniger gefährdet oder abgelenkt, sondern möchte unbedingt zur Kenntnis nehmen, was um mich herum so entsteht und gedacht, gefühlt, ausgedrückt wird. Ich halte mich für zu neugierig, um die kreative Außenwelt abzublocken; entgehen lasse ich mir ungern etwas; ich möchte mitbekommen, was passiert – auch im außerkünstlerischen Bereich. Ich sehe das alles als ein reichhaltiges Angebot der Welt an mich an, von dem ich mich verlocken lasse, das ich wahrnehmen und von dem ich kosten will.
Hast du Strategien, um dich vor Ablenkungen zu schützen?
Musik in all ihren Erscheinungsformen – Musik hören, Musik lesen, Musik schreiben und entwerfen, über Musik nachdenken, Musik als Ausführender vor Publikum zu Gehör bringen. Das funktioniert immer, ist die ideale Ergänzung für mich. Und ist mir auch sehr viel wichtiger als ein (potenziell langweiliger oder „in die Irre führender“) Abend mit Menschen. Musik schützt mich vor dem Überflüssigen und Entbehrlichen.
Wie sieht deine Arbeitsumgebung aus, was ist essenziell für dich? Brauchst du zum Beispiel absolute Stille – und wenn ja, wo und wie findest du sie?
Absolute Stille in der Tat! Keine Begleitmusik, kein Hintergrundgedudel. Ein lautloser, großer Raum nur für mich allein ist unverzichtbar. Durch die Auswirkungen arbeitstechnischer Umstrukturierungen, wie sie die Covid-Ära en passant hervorgebracht hat, arbeitet mein Mann, der zuvor täglich in Straßburg tätig war, nun auch die halbe Woche über von zu Hause aus; an diese stille Präsenz, obschon nicht wirklich störend, musste ich mich erst einmal gewöhnen. Ganz selten gönne ich mir einen kurzen Spaziergang durch die Weinberge, direkt nach dem Mittagsimbiss, um den Kopf freizubekommen. Höchstens zwanzig Minuten darf er dauern, damit der Gedankenfluss gewährleistet bleibt und das thematische Kontinuum nicht abreißt. Auch dort bin ich ganz für mich allein. Außerdem versuche ich, tagsüber nicht zu telefonieren. Nur die allernötigsten Anliegen kommen per Handy zur Sprache, nie aber führe ich ausführliche Dialoge. Das gestatte ich mir erst am frühen Abend.
Was auch hilft: zwei Laptops zugleich zur Verfügung zu haben, wobei man den einen (ohne das WLAN zu nutzen) ausschließlich für die Schreibarbeit verwendet und den anderen in einem anderen Zimmer stehen hat (und sich dann dort, alle paar Stunden für einen Zehn-Minuten-Break, mit gelegentlichen Mail-Checks „belohnt“). Bei diesem Verfahren strikter Trennung muss man freilich ehrlich zu sich selbst sein und darf sich nicht durch heimliche „Grenzüberschreitungen“ austricksen.
Wann und wo passiert der wichtigste Teil der Arbeit, wo findest du die größte Inspiration? Bei der Arbeit am Schreibtisch oder zufällig – unterwegs, in der Entspannung, auf Reisen, beim Lesen, im Austausch mit anderen Menschen?
Überall. Jede Situation, jede Reise und jeder Ausflug, jede wertvolle Diskussion, jeder wirklich wichtige Mensch tragen ihr Scherflein dazu bei, das etwas Sinnvolles, Überzeugendes reifen und entstehen kann. Da lässt sich keine der genannte Einflusssphären von der anderen trennen. Es gibt, selbstredend, lang gehegte Vorhaben, deren Dringlichkeit sich über Jahre hinweg zu einem echten Schreib- und Publikationsbedürfnis entwickelt, Buchthemen, die nach einem „schreien“, die man einfach machen muss, weil sich kaum sonst jemand dafür so gut eignet (wie man anzunehmen geneigt ist); andere, die einem fast ebenso am Herzen legen, wiederum schaffen es nie in Buch- oder Artikelform, vieles ergibt sich ganz spontan. Einiges an diesen Entscheidungen entzieht sich der eigenen Kontrolle, bleibt selbst im Rückblick unverständlich oder ein wenig rätselhaft. Gleichmut und Optimismus sind angebracht. Jedenfalls versuche ich, immerzu meine Ohren zu spitzen und vieles Faszinierende im Blick zu behalten. Bislang habe ich auf meine Sensibilität und Motivation verlassen können.
Inspiration wird überschätzt. An einer Sache/einem Thema dranbleiben, gegen alle Widerstände und Unwahrscheinlichkeiten, und es nicht aus den Augen lassen, es ernst nehmen und ihm bei der Niederschrift größtmöglichen Respekt zollen: Darauf kommt es an.
Wie oft oder leicht kommst du in einen kreativen „Flow“, und was hilft dir am meisten, um diesen Zustand zu erreichen?
Sehr leicht und ohne Probleme komme ich in diesen Flow. Einen solchen Zustand kann ich tatsächlich jederzeit hervorzaubern. Hilfs- oder Suchtmittel benötige ich nicht dafür. Wenn ein Verleger oder eine Programmchefin an ein Projekt genauso glaubt wie ich selbst, wenn er oder sie ebenfalls davon beseelt sind, ja dafür brennen, ist das zusätzlich eine ungeheure, mich anfeuernde Unterstützung. Wenn sie hingegen von Anfang an nur halbherzig bei der Sache sind, muss man aufpassen, dass man sich davon nicht anstecken oder gar demoralisieren lässt. Was einem Flügel wachsen lässt: bei Unbeteiligten durch das mitreißende Erzählen von einem Sujet, dem man sich gerade verschrieben hat, großes Interesse zu entfachen und zu merken, dass man sie dafür als Leser gewinnen könnte – das bereitet Vergnügen, das setzt echte Kreativität frei.
Was machst du, wenn nichts klappt – wenn Ideen oder Erfolg ausbleiben oder wenn dir nicht das gelingt, was du dir vorgenommen hast?
Spätestens dann kommt der Faktor Geduld ins Spiel. Sich nicht verrückt machen. Sich damit abfinden, dass man nicht alles – schon gar nicht den Erfolg (der sich ohnehin nicht objektiv „messen“ lässt) – kontrollieren oder steuern kann. Auf lange Sicht denken: In der Rückschau darf man konstatieren, dass man bereits einiges geschafft, dass man sich einen gewissen Ruf erworben hat. Darauf sollte man ruhig ein wenig stolz sein. Rückschläge muss man einstecken. Man kann nicht davon ausgehen, dass alles, was man zu Papier bringt oder musikalisch vorträgt, automatisch verfängt oder ankommt. Ferner sollte man sich nicht vorgaukeln, dass man sich oder anderen noch etwas beweisen muss, dafür hat man schon zu viel publiziert oder konzertiert. Sich kleine Lektionen in Bescheidenheit oder Demut zumuten, das ist zuweilen gar nicht von Übel – und auch gesund.
Was hilft dir, wenn dein Selbstvertrauen angeschlagen ist (z.B. wegen schlechter Auftragslage, schlechter Kritiken, finanzieller Flaute, schlechter Stimmung)?
Sich nicht aus der Fassung bringen lassen, vorübergehende depressive Episoden aussitzen, meditieren, sich erfolgreichere, frühere Phasen intensiv ins Gedächtnis zurückrufen. Kapieren, dass vieles, was die Außenwirkung betrifft, gar nicht in der eigenen Hand liegt und von unwägbaren Faktoren bestimmt wird. Beispiel Corona: Monate-, ja nahezu jahrelang musste man als Autor seinerzeit auf die Selbstverständlichkeit verzichten, dass sich an jede Buchveröffentlichung eine Lesereise anschließt, dass Sichtbarkeit für die Bücher geschaffen wird, dass Buchmessen stattfinden, dass Buchhandlungen geöffnet haben. Das hat mich mutlos und auch wütend gemacht, ab und zu gar verzweifeln lassen. Seitdem ist es nie wieder so rund und zufriedenstellend geworden, wie es vorher abgelaufen war – das betrifft jedoch alle in unserer Zunft. Eine bittere Erkenntnis, mit der man erstmal lernen muss, umzugehen und sie zu akzeptieren.
Mündlich geäußerte Kritik kann ich leichter wegstecken als schriftliche Verrisse. Letzteres wurmt, und man spürt auch sofort, ob an solcher Negativbeurteilung etwas dran ist oder nicht. Man kennt sich ja durch und durch, weiß auch um die eigenen Schwächen. Von extremen finanziellen Flauten bin ich bisher zum Glück verschont geblieben; schlechte Stimmungen beseitige ich durch besonders hartnäckiges Klavierspiel. Aber innen drin grummelt es natürlich noch ein Weilchen weiter.
Belohnst du dich, wenn du etwas geschafft, ein bestimmtes Ziel erreicht hast?
Eigentlich nicht wirklich. Lob, Zuspruch, Anerkennung durch Lesende und Hörende ist für mich Belohnung genug. Es erfüllt mich stattdessen mit einem länger währenden Glücksgefühl, wenn mir offenbar etwas geglückt ist. Wenn sich die Befriedigung im Schaffensprozess mit der Befriedigung beim (Lese- oder Konzert-)Publikum genau deckt. Da verdoppeln sich dann Glücksempfindungen, wenn ich feststellen darf, dass ich bei Lesern/Leserinnen oder Zuhörern/Zuhörerinnen Freude auslöse, ihnen einen schönen Abend beschert, sie mit einem Buch in den Bann geschlagen oder „food for thought“ für sie geschaffen habe.
Ansonsten werde ich Tag für Tag von meinem Mann, der mir in vielerlei Hinsicht den Rücken freihält, verwöhnt. Das ist Belohnung genug, noch dazu unabhängig von der Qualität meines künstlerischen Tuns.
Vertraust du auf den Rat anderer oder auf Ratgeber-Literatur? Gibt es Bücher, die dir geholfen haben, Mut zu finden auf deinem künstlerischen Weg?
Eher nicht. Nur selten tausche ich mich während des Schreibens oder Einstudierens mit Kollegen oder Wegebegleiterinnen aus, gebe auch keine Kapitel als „work in progress“ in fremde Hände. Anleitungen in Buchform habe ich weder gesucht noch gefunden, und ich komme, ganz überwiegend, auch ohne Mut aus. Ich denke und hoffe, dass ich mir meiner Sache meistens sicher sein kann.
Um es mit Oscar Wilde zu sagen: Am Ende wird alles schon irgendwie gut. Und wenn es ist nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Das ist keine alberne Tautologie, sondern hat sich für mich stets bewahrheitet.
Wie viel bedeutet dir die Anerkennung deiner Kunst durch andere? Was ist die beste Form der Anerkennung?
Anerkennung bedeutet mir sehr viel. Nicht nur Lob, das mir aus positiven Leserbriefen oder wohlwollenden, liebevollen bis hin zu euphorischen Kritiken entgegenschlägt, sondern spontane Bemerkungen, die Zuhörer direkt nach meinen Lesungen an mich richten. Überhaupt Applaus, die „Live“-Begeisterung zählt für mich mehr als alles andere. Da ich mich in erster Linie als performativer Autor verstehe und in meine Veranstaltungen ja auch immer Klavierspiel und eine visuelle Ebene einbeziehe, mich bemühe, meine Lese-Abende szenisch anzulegen und als kleine Gesamtkunstwerke dem Publikum nahezubringen, kann ich auf der Bühne am ehesten testen, aufgrund der Reaktionen der Menschen vor mir, wie einzelne Sätze, Handlungsmomente und Pointen „verfangen“, kann spüren, ob sie „sitzen“, ob der Aufbau einer Textpassage überzeugend gewesen ist, ob die Dramaturgie gestimmt hat. Oft ziehe ich daraus direkte Konsequenzen und formuliere schon für die nächste Lesung einiges um.
Auch die explizite Anerkennung durch Kollegen/Kolleginnen und Rezensenten, Instrumentalisten oder Autoren/Autorinnen, die ich selbst schätze oder bewundere, ist eine ganz besonders wohltuende Form des literarisch-musikalischen Kompliments.
Wovor hast du Angst?
Vor Vergesslichkeit, vor dem Verlust der selbst hergestellten Allroundbildung und vor Demenz. Vor der abnehmenden Fähigkeit, für bestimmte Themen entflammbar zu sein, in mehreren Sprachen zugleich denken, sprechen und schreiben zu können. Vor dem Unvermögen, weiterhin auf hohem Niveau Musik zu spielen und zu interpretieren. Davor, dass mir die Worte und Töne fehlen. Dass ich Sprache und Partituren, also die Wiedergabe von so linearen wie komplexen, an Verstand und Emotionen gebundenen Sinnzusammenhängen, nicht mehr beherrsche.